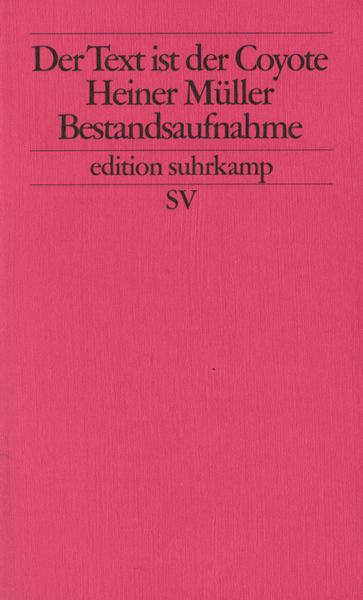Notizen zu Heiner Müller und Alexander Kluge von Christian Schulte
I
Nach dem Ende der DDR war ihm für einige Jahre das Material seines Dramas abhanden gekommen. Heiner Müller schrieb Gedichte und gab ein Interview nach dem anderen. Ein fortlaufender Text gesprochener und dann abgedruckter Müller-Worte, der oft provozierend die gegenwärtige Entwicklung und erhellend die eigene Arbeit kommentierte, manchmal aber auch inflationär bekannte Positionen wiederholte. „Ich bin wahrscheinlich viel zu sehr Schauspieler und deswegen ungeheuer abhängig vom Interviewpartner, also von dem, der mich fragt, und da gibt’s eben Leute, wo ich völlig mechanisch werde oder keine Lust habe. Aber das Schlimmste dabei ist die ewige Wiederholung der Fragen vom gleichen Typ.“
Diese Selbstbeobachtung formulierte Müller in einem Gespräch mit Alexander Kluge, in dessen Kulturmagazinen er von der Wende an bis zu seinem Tod regelmäßig zu Gast war. Wer sich in Kluges Ausdrucksreservate einschaltete, konnte zu später Stunde Dialoge verfolgen, die so noch nie im TV zu sehen und zu hören waren und deren Inkommensurables jedem Kenner der Magazine spätestens nach dem Tod Müllers schmerzlich bewußt geworden sein dürfte: Kluge als Fragensteller und Souffleur fast durchgängig im off, Müller mit Zigarre und Whisky groß im Bild – dieses Dispositiv bildete den Rahmen für Landvermessungen, die in Wahrheit Geschichtsvermessungen waren, assoziative Flanerien, bei denen Müllers Texte oft die Vorlage lieferten für spekulative Digressionen, die im gängigen Fernsehen keine redaktionelle Kontrolle passiert hätten. Man sah zwei Autoren bei der Arbeit zu, bei der Entstehung ihrer Gedanken beim Reden, Wahlverwandte, die das Experiment einer Begegnung vor laufender Kamera eingingen, mit der einzigen Absprache: „Jeder konzentriert sich auf den anderen.“ Die Gespräche, die auf diese Weise entstanden, lassen sich dem schematisierten Genre des Fernsehinterviews kaum zuordnen, allzu offensichtlich verkehrt Kluge die Konventionen des rituellen Talks probehalber in ihr Gegenteil, eine Verkehrung, die weniger einer Absicht entspringt, als vielmehr der Lust am Gespräch, an einem Austausch, der sich gleichgültig gegenüber der Frage verhält, ob Zuschauer (und Leser) den Dialogen einen informationellen Mehrwert abgewinnen können oder nicht und dessen heimliches Motto lautet: „Die Befreiung des Ausdrucks vom Zwang des Sinns.“
Fern von jedem Standpunktdenken haben die Begegnungen zwischen Kluge und Müller nichts von einer Duellsituation; es handelt sich vielmehr um Versuche, das von Film und Theater her vertraute Ideal kooperativer Arbeit mit den Mitteln des Fernsehens zu retten, nur eben ohne den Rabatt, den das Medium üblicherweise gewährt. Es geht um Geschichte, um die Rolle der Intelligenz und um die Aufgabe des Theaters, um Inhalte also, die doch stets mit der performativen Dimension des Sprechens selber konkurrieren. Nicht die kausallogische Stimmigkeit eines Gedankens, eines Arguments, d.h. die Entscheidung über Konsens oder Dissens steht hier im Vordergrund, sondern die Erzeugung einer spezifischen Wahrnehmbarkeit, nämlich der Art und Weise, wie die Gedanken die Bühne des Dialogs betreten. Enge Fokussierung und große Brennweite, Nähe und Ferne, das Eigene und das Fremde, das sind die Pole, zwischen denen sich dieses dialogische, mehrschichtige Erzählen bewegt. Etwa wenn Kluge in einer Sendung, die im Anschluß an Müllers schwere Speiseröhren-Operation aufgezeichnet wurde, dessen Stichwort „Postoperatives Trauma“ aufgreift, um gleich darauf zu fragen: „[…] gibt’s das bei Völkern?“ In einer anderen Sendung interessiert er sich im Anschluß an Müllers Exkurs über Drogenerfahrung in der Antike auf einmal für „Aurora, die Morgenröte, Eos. Beschreib mir doch mal Morgenröte. Morgenaufgang, was bedeutet das?“ und – wieder an anderer Stelle – für den Mond, der bei Müller eine Kindheitserinnerung (den Tod Hindenburgs) evoziert. Für derart sprunghafte Verknüpfungen ließen sich viele Beispiele anführen. Wie eine Hebamme (im Kleistschen Sinne) versucht Kluge mimetisch, auf dem Weg der Beschreibung, bei seinem Gegenüber Erfahrungskerne freizulegen, um das so vergegenwärtigte Material dann versuchsweise in neue, unerwartete und oft imaginäre Perspektiven zu rücken.
Wenn Müller Brechts Auffassung zur Haltung des Künstlers referiert: „Zu lernen vor allem ist Einverständnis, das muß man lernen, einverstanden sein mit Entwicklungen, mit Prozessen“ , so charakterisiert er damit zugleich eine Eigenschaft, die auch die Gespräche mit Kluge fundiert: die Fähigkeit beider Autoren, von sich selbst absehen zu können, sich zum Schauplatz von Szenen zu machen, in denen die Stimmen der Vergangenheit in immer neuen Konstellationen in die Gegenwart hineinsprechen. Es ist diese mediale, selbstvergessene, trans-subjektive Redeform, in der sich Geschichte – Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit – als zusammenhängender Erfahrungshorizont zu erkennen gibt. Ein solches Sprechen kennt nicht länger die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Kommentar; wenn unter dem dialektischen Blick der Sprechenden alle geschichtlichen Ausdrucksformen – in welcher Intensität auch immer – zueinander relational sind, dann gewinnt es sein Spezifisches gerade dadurch, daß es beide Optionen in der Schwebe hält. Aus diesem Grunde stellt sich als erstes die Frage: Wer bzw. was spricht hier überhaupt? Und wer mit wem? Kluge mit Müller? Müller mit Shakespeare? Nero mit Stalin? … Und was authorisiert dieses Sprechen? Die intime Kenntnis der Stoffe oder die Vorstellung, daß es so oder ähnlich gewesen sein könnte? Die Frage zersplittert sofort in mehrere Teilaspekte, in neue Fragen, die signalisieren, daß es unwichtig sein könnte, sie beantworten zu wollen und wichtiger, ihrem Gestus zu folgen, der selbst ein fragender ist. Am deutlichsten wird dies paradoxerweise an der apodiktischen Behauptung Müllers, daß es zu Auschwitz „noch keine Alternative“ gebe, ein ungeheuerlicher Satz, auf den unsere political correctness sofort allergisch reagiert, weil er ein Denk- und Sprachtabu verletzt. Vom moralischen Standpunkt aus müßten wir empört reagieren und in Müller den kalten Zyniker sehen; erklärten wir uns dagegen einverstanden damit, daß einer ausdrückt, was ihm durch den Kopf geht, würden wir umso aufmerksamer den Kontext beachten, in dem der Satz fiel. Wir würden bemerken, daß Müllers Aussage keineswegs eine Verharmlosung des deutschen Zivilisationsbruchs darstellt, sondern vielmehr eine von Kluge stimulierte Denkbewegung über die Selektion als globales „Prinzip der Politik“ initiert, für das der Name Auschwitz als historischer Signifikant einsteht. Der Gedanke sucht und befragt sich gewissermaßen selbst und findet sich schließlich in der vorläufigen Formulierung: „Ich meine einfach, daß alles, was denkbar ist, auch machbar ist. Und alles, was machbar ist, wird gemacht.“ Kluge interessiert sich für das Motiv, das Müllers Zuspitzung zugrundeliegt und folgert: „Das mußt du jetzt in einen Satz kleiden, der unverdaulich ist. Denn sonst ist es ein Verrat. […] Und dies ist genau das, was eine plurale Gesellschaft nicht aushält. Sie fordert die Sentimentalisierung […].“ Was sich hier lernen läßt, ist, daß Antworten immer schon Vereinfachungen sind, resultatförmige Sinngebungsversuche, die sich gerade auch in unserer monologischen Betroffenheitskultur konsumieren lassen. Wie stark das Bedürfnis nach dem tröstenden konsensfähigen Ton ist, läßt sich ermessen, wenn man die vielen history-Reihen und Diskussionssendungen, die unter dem Logo Aufarbeitung der Vergangenheit laufen, einmal unter dem Gesichtspunkt ihrer Diversität betrachtet. Man wird sie nicht finden, denn Abweichungen vom Schema gelten in den Redaktionen als Risiko. Diese nivellierte Form der Geschichtsvermittlung, die das, was uns brennend angeht und beschäftigen sollte, aus Gründen der Berechenbarkeit (der Quotensicherung) in einer neutralen, entindividualisierten und unsere Aufmerksamkeit ermüdenden Sprache abhandelt, wird durch Kluges Kultur der Vielfalt im selben Medium skandalisiert – nie durch Polemik, sondern schlicht durch ihre Differenz.
II
Es ist denn auch nicht allein der Werkstattcharakter, der die Gespräche mit Müller zu eigenständigen Segmenten in den Werkzusammenhängen beider Autoren macht , es ist ebenso die strukturelle Homologie, die sie im Verhältnis zu Poetik und ästhetischer Eigenart der literarischen Arbeit Müllers und Kluges aufweisen. Gewiß stehen die klassizistischen Sentenzen in Müllers Stücken und die erkennbar stilistische Geformtheit seiner Prosa in einem deutlichen Gegensatz zur spontanen Wechselrede eines Fernsehgesprächs, aber der weitgehende Verzicht auf Intentionalität, der dieses Sprechen charakterisiert, korrespondiert unmittelbar mit der auktorialen Haltung, die der Organisationsform des Materials in Müllers Traumtexten und späten Dramen ebenso zugrundeliegt wie den Montageformen in Kluges Geschichten (und Filmen). In einem Gespräch mit Rainer Crone aus dem Jahr 1988 vergleicht Müller den Prozeß seines Schreibens mit dem action painting: „Man rennt auf eine Leinwand zu und wirft Farbe ran und weiß nicht, was rauskommt. […] Das kenn‘ ich auch beim Schreiben. Da gibt’s Momente, wo man überhaupt nicht weiß, was man macht. Das gehört dazu, sonst wird es nichts. Solange man weiß, was man macht, entsteht keine Kunst.“ Er folge „weniger Strategien als Bedürfnisse[n]. Ich würd‘ von mir aus sagen, einfach das Bedürfnis, nichts zu machen, was man schon kennt, nichts zu schreiben, was man schon weiß. Ein Grundimpuls ist Neugier. Es geht eher um Finden als um Suchen.“ Kunst als notwendiges Ausdrucksbedürfnis, das sich gierig an dem entzündet, was es vorfindet: ein Satz in einem Buch, Redefetzen am Nebentisch („was während des Schreibens passiert, gehört zum Text“ ) – was Müller hier beschreibt, ist eben das, was auch Kluge interessiert: die dem Schreiben vorausliegende Motivstruktur, die Frage, wie etwas entsteht. Was ist das affizierende Moment, das einen veranlaßt, etwas Bestimmtes zu tun? So ähnlich, wie er in Schlachtbeschreibung danach fragt, was 300 000 Mann dazu bringt, nach Stalingrad zu marschieren, an einen Ort, an dem keiner von ihnen etwas zu suchen hatte. Dabei liegt der Ausgangspunkt, an dem sich Müllers Schreibmotiv kristallisiert, jenseits der Sprache, in einer räumlich-bildlichen Vorstellung: „das erste, was auftaucht, ist ein Gefühl für einen Raum und für die Positionen der Figuren im Raum und zueinander. Daraus entstehen erst allmählich Dialog oder Text; aber zuerst ist eigentlich etwas Nicht-Verbales da.“ Es ist diese außersprachliche, dem Verstehen vorgängige Wahrnehmungsqualität, der in Müllers Utopie des Theaters ein zentraler Stellenwert zukommt. Unter dem Eindruck von Robert Wilsons Inszenierung der Hamletmaschine zeigt er sich fasziniert von einer Darstellungspraxis, die der körperlichen Seite der Sprache den Vorrang gibt vor ihrer mitteilenden. Reduziert diese den Text auf eine Bedeutung, so entdeckt jene als lebendiger Ausdruck „plötzlich Schichten unter der Mitteilung“ , die den Text auf seinen semantischen „Nullpunkt“ führen, ihn in einen Körper verwandeln, der sich zunächst nur der sinnlichen Wahrnehmung der Zuschauer offenbart, nicht aber ihrem „erkennungsdienstlich[en]“ Wunsch, ihn zu begreifen. „Das entzieht sich ihnen, und dieser Entzug von Bedeutung ist ganz wichtig, den Leuten die Möglichkeit zu nehmen, eine Sache auf eine Bedeutung festzunageln.“
Auch bei Kluge ist es eine „idée fixe“ , ein erstes Bild, in dem bereits die Geschichte virtuell enthalten ist und das sich im Prozeß ihres Ausphantasierens wiederum in Proportionen, Montagezusammenhänge auflöst. Als Subjekt dieses Übersetzungsprozesses vom Motiv zur sprachlichen Form bezeichnet Kluge den „Antirealismus des Gefühls“ , der – subkutan, unterhalb des absichtlichen Wollens – auf die äußere Wirklichkeit mit Protest reagiert, ein Gefühl, das, wie er in bezug auf eine seiner Geschichten ausführt, „eine Trotzki-Rede auslöst, die er in die Maschine hämmert, so“, heißt es weiter, „wie noch Heiner Müller seine literarischen Texte über Titus Andronicus, Shakespeare-Maschine, Shakespeare-Fabrik, in die Maschine hämmert. Das ist eine durchgehende Bemühung. Genauso irrtümlich wie viele andere Impulse und dennoch in den Texten vertrauenswürdig.“ Und an anderer Stelle heißt es: „es muß die Geschichte selber eine gewisse Hysterie erzeugen, damit der Text von selber herausspult.“ Die Anklänge an die écriture automatique, den stream of consciousness sind unüberhörbar, doch geht es mehr noch um die Fehler, die sich ergeben, wenn die Hysterie die Grammatik der Texte reguliert. Sie schreiben sich als kontingente Spur des subjektiven Erfahrungshorizonts und der besonderen Situation ihrer Entstehung, als Wirklichkeitssplitter in die Texte ein, als unwägbares, allen Absichten entzogenes Moment. Es ist dieser Gestus des Imperfekten, der seinen Arbeiten den „Charakter einer Baustelle“ verleiht und der kanongläubige Kritiker bisweilen veranlaßt hat, sie aus dem Erhabenheitsbezirk des Literarischen auszuschließen. Denn Kluge verzichtet darauf, „die niedergeschriebenen Geschichten nachträglich ‚auszubessern'“, weil „die Form, in der die Geschichten erzählt sind […] ein Gefühl [ist], das nur einmal mißt, und war es theoretisch […] falsch, dann ist es falsch und mißt so auch.“ Kluges Geschichten sind „Geschichten ohne Oberbegriff“ , weil sie sich dem Paratext des Realen aussetzen. So wie in den Filmen Versprecher nicht ausgemustert werden und in den Fernsehmagazinen gelegentlich das Interview von der Geräuschkulisse des Ortes übertönt wird, setzen sie den Status des Literarischen bewußt aufs Spiel setzen, indem sie möglichst viele außerliterarische Rohstoffe (Zitate aus der Sprache der Administrationen, Bilder und, in den Filmen, dokumentarische Sequenzen) als authentische Zeugnisse, wiedererkennbare Originaltöne in sich aufnehmen. Diese Verankerung der Texte in konkreten Erfahrungszusammenhängen, die zugleich ihr Risiko und die Bedingung ihres Gelingens ist, beruht auf der Überzeugung, daß.heute die eigentlichen Romane von der Wirklichkeit selbst geschrieben werden, einer Wirklichkeit, die dem einzelnen Menschen als babylonischer Hochbau der Abstraktion, als Menetekel voller Kleingedrucktem gegenübertritt. Kluge begreift seine literarische Arbeit als Lesehilfe, die erzählend, kommentierend den vielfach übereinandergeschriebenen Text der Realität in eine für die sinnliche Wahrnehmung zugängliche Form zurückübersetzen soll.
Es ist dieser Blick auf eine antagonistische Wirklichkeit, der nicht nur die offenen, unabgeschlossenen Formen seiner Texte bestimmt, sondern ebenso Auswirkungen auf die dargestellten sujets, die Figuren und ihre Handlungen hat. Wie so etwas aussieht, darüber geben die Geschichten, die Kluge über Heiner Müller geschrieben hat, einigen Aufschluß. Abschließend ein Beispiel: In Heiner Müllers letzte Worte über die Funktion des Theaters sitzt der schwerkranke Dramatiker aus Anlaß der Premiere seines Philoktet wenige Tage vor seinem Tod einem jungen ehrgeizigen Journalisten gegenüber, der ihn interviewen will. („Müller war in diesen Tagen für manche Stunden unverteidigt. Er konnte sich nicht mehr dazu aufraffen, ein Gespräch zu verweigern oder abzubrechen.“) Der Volontär ist entschlossen, die Situation zu nutzen, er fragt betont kritisch nach Müllers Meinung zum mäßigen Erfolg der Aufführung; Müller dagegen hat Schmerzen, ist hungrig, kann aber die gereichten Buletten wegen seiner „beschädigte[n] Speiseröhre“ nicht essen. Er läßt sich schließlich entnervt auf das Gespräch ein („Jede andere Maßnahme zur Änderung seines Befindens wäre quälender gewesen.“) und schreibt abschließend etwas auf einen Bierdeckel, den er dem Journalisten schenkt. Kluges Geschichte beschreibt die unspektakuläre Kollision zweier Bedürfnisse, die zunächst unvereinbar erscheinen: Müller will seine Ruhe haben, der Volontär will Beute machen. Weder der Wille des einen noch der des anderen trägt etwas zur Lösung bei. Das Subjekt der Geschichte, das den beide befriedigenden Ausweg aus der Situation weist, ist das „Gefühl“ des Todkranken, das danach drängt, „etwas am augenblicklichen Zustand zu verändern“. Der „Antirealismus des Gefühls“ verwandelt hier unwillkürlich die Belästigung des Journalisten in ein Gegengift, das den Dramatiker für eine Weile von seinen Schmerzen ablenkt. Die Lektüre des Textes verlagert den Akzent des Titels: er liegt nicht mehr auf Müllers Ausführungen zur Funktion des Theaters, sondern auf „letzte Worte“.
Quelle: Der Text ist der Coyote. Heiner Müller Bestandsaufnahme, hg. von Christian Schulte u. Brigitte Maria Mayer, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004.