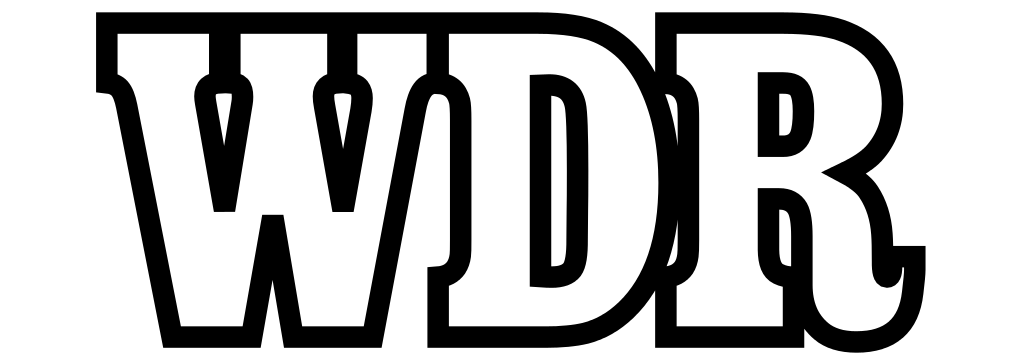Quelle Westdeutscher Rundfunk – 3. August 1964
Hatte Alexander Kluge in seinem ersten Buch, den „Lebensläufen“, sich an Einzelheiten gehalten, an Einzelfiguren, Einzelschicksale, Einzeldiagnosen, so gleicht das neue, „Schlachtbeschreibung“, eher einem Panorama, in dem das Einzelne als Baustein, als Mosaikklötzchen sich mit vielen seinesgleichen zum Totalgemälde ergänzt. Nach den, wenn man das sagen kann, „Novellen“ nun also der „Roman“? Hier wie dort die neue, neuen, oder besser: aktuellen Stoffen angemessene Kompositionsweise; doch statt der Einzeleinstellung nun die Totale?
Zwei der soeben verwendeten Begriffe bieten Ansätze für eine Beurteilung der „Schlachtbeschreibung“: der des Panoramas und der der Totale.
Ein „Panorama“ malte der Historienmaler Anton von Werner von der Schlacht bei Sedan. Dolf Sternberger hat dieses Rundgemälde als Schlüssel für eine ganze Ära benutzt. In einem entscheidenden Augenblick der kriegerischen Aktion (oder in einem zum entscheidenden vom Maler umretouchierten) erscheinen die kämpfenden Parteien erstarrt in einer Pose, die unmittelbar vor der Wendung zu Sieg oder Niederlage haltmacht. Der Betrachter steht wie auf jenem imaginären Feldherrnhügel, von dem aus das Geschick der Kämpfenden nichts Zufälliges mehr hat. Im Bild wird versucht, die Quintessenz des komplexen und weiträumigen Vorgangs der Schlacht (der ja zugleich topographische, strategische, stereometrische, politische und menschliche Elemente in sich faßt) zu entdecken vermittels naturalistischer, ja (wie Sternberger gezeigt hat) höchst illusionistischer Darstellung des entscheidenden Moments.
Kluge, so könnte man sagen, dreht die Tendenz der Panoramamalerei um. Er zerlegt den komplexen Vorgang in eine Vielzahl von Berichtsmomenten, darin etwa den Rapport reproduzierend, den ein Oberbefehlshaber aus vielen Detailfakten als Grundlage für seine Entscheidungen zusammensetzen muß. Aber der Standpunkt ist nicht so eindeutig wie es der eines Befehlshabers wäre. Entschiedener noch als der Panoramamaler hebt Kluge seinen Leser über alle realistisch fixierbaren Perspektiven hinaus in eine Position, in der er schließlich den Vorgang aus dem Vexierbild der Mitteilungen erst erraten muß. Die Einzelinformationen, die der Autor über seinen Gegenstand gibt, sind dabei nicht ununterschieden nebeneinander gestellt, sie sind in Reihen geordnet, die sich in Schichten verschiedener Perspektive überlagern. Diese Schichten ergänzen einander, widersprechen sich aber auch an einzelnen Stellen. Das sprachlich Mitgeteilte wird nicht definitiv. Die einzelne Formulierung verdinglicht sich und verliert den übergreifenden Sinngehalt. Die Kombination solcher Formulierungen verhält im Infiniten. Das Definitive erschließt sich, wenn überhaupt, nur aus den Überlagerungen der infiniten verdinglichten Formulierungen.
Konkreter gesprochen: Kluge setzt seine „Schlachtbeschreibung“ aus mehreren Dokumentar- und Berichtsabläufen zusammen. Die Schlacht, es handelt sich um den Kessel von Stalingrad im Winter 1942/43, erscheint in der Spiegelung erstens der deutschen Wehrmachtsberichte, zweitens der Anweisungen des nationalsozialistischen Reichspressechefs, drittens in den Richtlinien für den Winterfeldzug in Russland, viertens in den Predigten von Wehrmachtspfarrern, fünftens in einer Montage aus authentischen Einzelinterviews, sechstens in Berichten von Ärzten über Wunden und Krankheitsbilder während der Kesselschlacht und schließlich in einer Art übergeordneten Diariums, das Tag um Tag, in Konvoluten zum Teil disparatester Meldungen, rekapituliert. In den ersten sechs Reihen handelt es sich ausschließlich um die Auswahl und Kombination dokumentarischen Sprachmaterials, deren Zusammenstellung, im erhellenden, entlarvenden oder diffamierenden Sinne, für sich selbst spricht. In der letzten Reihe versucht Kluge ein freieres Verfahren, das, literarisch gesehen, mit bestimmten Praktiken der radikalen Moderne verglichen werden kann. Zugleich reproduziert er eine Erscheinung der modernen Nachrichtentechnik, die man an jeder Zeitungsseite oder an jedem Rundfunknachrichtendienst ablesen kann. Er versucht das literarische Prinzip der Montage mit dem informationstechnischen des Nachrichtenwesens auf einen Nenner zu bringen, ja sie miteinander zu identifizieren.
Die „Schlachtbeschreibung“ liefert demnach kein Bild, sondern eine Mehrzahl von Sprachmustern, gewissermaßen Sprachmatrizen, in die die Realien nach jeweils andersartigen Auswahl- und Rasterprinzipien eingedrückt erscheinen. Das „Bild“ der Schlacht stellt sich dar als eine Dokumentation aus verschiedenartigen Überlieferungen.
Kluge beschränkt sich jedoch nicht darauf. Er fügt diesen literarisch dokumentarischen Teilen zwei weitere hinzu, die man, unter dem Titel des ersten Teils, als „Rekapitulationen“ bezeichnen kann (die „Personenliste“, die dazwischengeschoben ist, bildet lediglich einen Anhang zum ersten Teil).
Die „Spiegelung“ der ersten sechs Kapitel drückt sich aus in der Verwendung vorformulierten, ja zum Teil reglementierten Sprachmaterials. Die Tätigkeit des Autors besteht nicht in der Organisation der sprachlichen Abläufe bis hinein in ihre geringsten vokabulären und syntaktischen Nuancen, sondern darin, daß er in einer wechselnden Schnitt-, Kombinations-, Verdopplungs- und Kontrastierungstechnik dem Vorfixierten mehr abzwingt als es von sich aus zu geben vermag. Der Gegenstand entzieht sich der definitiven literarischen Benennung. Nur indem er in der Kombinatorik verdinglichter Sprachmaterialien erscheint, wird etwas über seinen Charakter deutlich. Wenn der Vorgang allein im Medium von Wehrmachtsberichten, Presserichtlinien, anonymem Interviews, disparaten Informationskatalogen, also in einer zugleich höchst formalisierten und absolut unpersönlichen Sprache, sichtbar zu machen ist, wenn die angemessenste Form der Darstellung sich auf die, allerdings mit großer Akribie und nicht ohne entlarvende Effekte vorgenommene Bereitstellung gerade dieses Belegmaterials zurückzieht (aus dem ja nach landläufiger Auffassung ein Schriftsteller erst eine „originale“ Nacherzählung zu „formen“ hätte), dann bedeutet das zuerst und vor allem anderen, daß dieser Vorgang absolut sinnblind ist. Das Geschehen wird, in der Darstellung, seiner dinghaften Sinnlosigkeit überführt. Die Darstellung gewinnt ihre Berechtigung allein aus der Demonstration der Sinnlosigkeit. Hierin liegt die Aufgabe des Autors, und das Kriterium für seine Arbeit findet sich in dem Grad, in dem es ihm gelungen ist mithilfe seiner Montagetechnik das dinghaft Uneinsehbare, aber Vorhandene unwiderleglich zu machen. Wie weit dies Kluge gelungen ist, könnte ein Vergleich mit Theodor Pliviers Stalingradbuch zeigen. Dort wird die Sinnlosigkeit nicht durch eine Methode der Berichterstattung oder der Sprachbehandlung deutlich, sondern in der Schilderung verzweifelter Menschen. Eben diese Schilderung verzweifelter Reaktionen dringt nicht bis zum Kern vor, weil in der noch so entfernten Bezugnahme auf die Regungen des Gemüts ein Ansatz zur Versöhnung mitgegeben ist, der die Undurchsichtigkeit des Vorgangs (die ja auch bei Plivier gezeigt wird) zu etwas vergleichsweise immer noch Erträglichem herabmildert. Ich sehe das eigentliche und größere Verdienst der Klugeschen „Schlachtbeschreibung“ darin, daß es ihm gelungen ist, die literarisch angemessene Methode an einem aktuellen Gegenstand zu demonstrieren und zu zeigen, in welcher Richtung sich heute eine erzählerische Technik zu entwickeln vermag und welche Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks für einen solchen Gegenstand indifferent bleiben.
Problematischer scheint mir der andere Aspekt seiner Arbeit. In der ausdrücklichen „Rekapitulation“ versucht er, den verlorenen Sinnbezug nachzuholen. Gewiß wird er auch hier nicht definitiv, das wäre zu plump. Aber er grenzt ein, gibt Stichwörter, akzentuiert. Im Grunde wechselt er von der Position des literarisch zu beurteilenden Autors in die des Geschichtsschreibers über (wie in den „Lebensläufen“ gelegentlich in die des Moralisten). Indem er das tut, wird er gezwungen, die sprachliche Methode zu ändern. Er kann sich nicht mehr mit der Montage begnügen. Er muß selber formulieren. Diese Schwierigkeit versucht er zu umgehen, indem er seinen eigenen Stil anonymisiert. Dennoch kann er nicht vermeiden, daß etwa seine Fragespiele in eine, von der Akzentuierung der Inhalte erzwungene, ungewollte Suggestivität geraten, daß seine Personalergänzungen gewisse Urteil, Anschauung und Einsicht erfordernde, charakterisierende Züge haben. In beidem gerät Kluge an eine Grenze. Wenn er eine Fragekette ansetzt, um Alternativentscheidungen zum Verhalten des Befehlshabers der 6. Armee, General Paulus, vorzustellen und diese mit dem Satz enden läßt: „Also entweder tot oder außer Dienst“, so gerät er unfreiwillig in die Gefahr eines geschichtsschreiberischen Dilletantismus, der seinen Gegenstand in ein unverbindliches Gerede verwischt. Wenn es zu General von Reichenau heißt: „Das Vaterland ist die eigene Existenz und die der Kameraderie; eine also vollkommen freie Bewegung in dieser Welt; v.R. dieser Welt gegenüber: wie ein Räuberhauptmann und seine Mannschaft“, oder zu General Paulus: „Zuletzt physisch gebrochen, physisch stark strapaziert, quittegelb. Eher schwermütig“ – so treibt die ausmalende Phantasie der Vorstellungskraft, die doch in den ersten Kapiteln als unangemessen für diesen Gegenstand erkennbar wurde, Blüten, die man, milde gesagt, nur als merkwürdig bezeichnen kann. Es deutet sich darin ein Mißverständnis an, das an einem weiteren Punkt vielleicht noch deutlicher zu machen ist. Kluge schreibt im Vorwort: „Die durch die häufige Nennung abgestumpften Namen sind teilweise abgekürzt oder geändert.“ In der „Personenliste“ ist das Verhältnis von chiffrierten zu ausgeschriebenen Namen 53 zu 10. Kluge will auch die Namen anonymisieren. Er gerät aber dabei unversehens in einen Kult der Abkürzungen, der sich immer wieder pseudoliterarisch verselbständigt. Ein angemessenes Mittel verwandelt sich in einen bloßen Reiz, der nicht nur beiläufig, sondern sogar störend ist. Wo es darauf ankommt, Sensibilität für die selbstgewählten Sprachmittel zu bezeugen, rutschen diese Mittel dem Autor aus der Hand und verkehren sich in die Parodie der eigenen Methode.
Vielleicht läßt sich ein Grund dafür andeuten, wenn man den zweiten Begriff noch einmal aufnimmt, den ich am Anfang als möglichen Schlüssel für die „Schlachtbeschreibung“ bezeichnet habe, den der Totale. Dieser Begriff stammt aus der Sprache des Films. Im Gegensatz zu den einzelnen Detaileinstellungen, aus denen sich die Erzählsprache des Films zusammensetzt, bezeichnet er die Erfassung des ganzen Schauplatzes und des versammelten Darstellerpersonals. Nicht im äußeren, faktischen oder darstellerischen Sinne, wohl aber im übertragenen, geistigen scheint Kluge eine solche Totale für sein Buch vorgeschwebt zu haben. Wenn er am Anfang sagt: „Das Buch beschreibt den organisatorischen Aufbau eines Unglücks“ – und endet mit einem Diderot-Zitat: Aucun homme n’a rec u de la nature le droit de commander aux autres – (kein Mensch hat von Natur das Recht, andere zu kommandieren)“ – so versucht er trotz allem seinen Gegenstand in einen großen, ja in den größten welthistorischen und philosophischen Sinnzusammenhang zu stellen. Mag das in Vorwort und Motto noch als schärfstes Kontrastmoment zur Sinnlosigkeit des Vorgangs selbst hingenommen werden, so wirkt die welthistorische Durchdringung im Text selbst völlig unangemessen, ja nebulös. Die geistige Totale läßt merkwürdigerweise gerade das, was sie versammeln soll, völlig verlöschen. Sie verkehrt den Gegenstand in sein Zerrbild. Als „Wendepunkt abendländischer Geschichte“ gerät er ins Zeitungsschlagwort. Das hätte natürlich gespürt und, als eine neue und entscheidende Dimension, parodierend benutzt werden können. Kluge hat das nicht vermocht.
Das mindert nicht den grundsätzlichen Wert seines zweiten Buches. Vielleicht kann das, was ich als mißlungen ansehe, lehrreicher wirken als ein vollkommen geglücktes Werk.