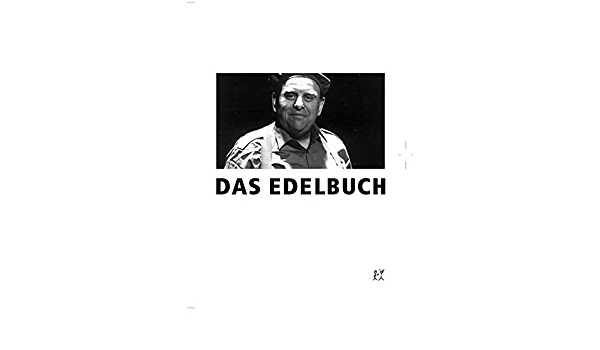Alfred Edel revisited
„Das Nichtverfilmte kritisiert das Verfilmte“, die Nebensache kritisiert die Hauptsache – dieses Credo war ein zentraler Bestandteil des Autorenprinzips, wie Alexander Kluge es einst formulierte. Umgesetzt wurde es in Kluges Filmen auf kongeniale Weise von Alfred Edel. Ob in der Rolle des Staatsanwalts, des Werkschützers, des Bundestagsabgeordneten oder des eitlen Hochschulassistenten, die zumeist kurzen Auftritte Edels genügten, um als Kraftzentren ganzer Filme in Erinnerung zu bleiben: die Nebenrolle kritisiert die Hauptrolle. Welcher Drehbuchschreiber hätte sich die cholerischen Suaden ausdenken können, die er – ausgestattet nur mit einer abstrakten Rollenidentität – vor laufender Kamera improvisierte. Und improvisieren mußte – und sollte – er. Was für jeden Schauspieler den Ernstfall bedeutet hätte, nämlich sich keine Texte merken zu können, war Edels beste Eigenschaft. Edel entschied nicht über den Ausnahmezustand, er verkörperte ihn, darin lag seine Souveränität. Die Rollen, die er spielte, waren nichts als Anregungen für den Charakter, der er war. Besonders lag ihm die des Karrieristen, etwa als aufstrebender Politologe in Abschied von gestern, der in der verunsicherten Anita G. ein willkommenes Opfer für seine Selbstinszenierung als akademische Autorität vor sich hat. Edel treibt die Klischeesierung der Figur – ebenso beiläufig wie narzistisch fragend „Kennen Sie mich schon?“ – so weit, daß sie als Typus erkennbar wird und damit eigentlich schon erledigt ist. Das war seine Art der Kritik: wiedererkennbare Typen zu schaffen, in deren Hohlform er sich ausagieren konnte. Was er spielte, war durch und durch Mimikry, das Nachsprechen gesellschaftlicher Tonlagen, deren Maskenhaftes, sobald er ansetzte, jedem transparent wurde. Darin eine Absicht zu vermuten, wäre wohl eine Überinterpretation: Edels Ironisierungen des Sozialen verdankten sich vielmehr dem Bedürfnis, für seine Erfahrungen einen präzisen sprachlichen Ausdruck zu finden, aber ebenso dem Bewußtsein, daß die Sprache dies nur unzureichend vermag. Daher die hysterischen Volten in seiner Rede, die unausgesetzte Pointensuche, die durch Mimik und Gestik vorangetrieben wurden. Kluge dürfte sich vor allem für diesen Ad-hoc-Realismus interessiert haben, mit dem Edel auf jede Situation authentisch reagieren konnte – weil er gar nicht anders konnte.
Daß Kluge auch nach seinem Wechsel zum Fernsehen auf die Zusammenarbeit mit Edel einige Hoffnung gesetzt hat, davon zeugen die wenigen gemeinsamen Sendungen, die bis zu Edels Tod entstanden und auch die Hommagen an den Freund, die Kluge anschließend produzierte. Sie hießen: „Die schönsten Szenen aus Filmen mit Alfred Edel“, „Das große Zeitgeist-Gespenst“, „Der Mann zwischen den Zeiten“ oder „Adieu für Alfred Edel“. Aber anders als in den Beiträgen mit dem ebenfalls verstorbenen Hans-Friedrich von Homeyer, der uns in vielen frühen Sendungen als Ex-Stasi-Oberst Komorowski begegnet, und mit dem in immer neue fiktive Rollen schlüpfenden Peter Berling, befragt Kluge Edel als Alfred Edel. Diesen sehen wir im Zug auf dem Weg zu einer ihm gewidmeten Werkschau oder am Küchentisch in Kluges Münchner Arbeitswohnung, mit bunt karriertem Jacket und einer unter dem Hemdkragen verschwindenden roten Krawatte, die neugierigen Augen immer auf sein Gegenüber gerichtet, lächelnd, auf Einsätze lauernd. Die Situation ist intim. Kluge fragt Edel nach seiner Kindheit, und wir erfahren von der engen Beziehung zur Mutter, die das Einzelkind behütete, vom frühen Tod des Vaters, der Notar gewesen war, und vom hohen Erfolgsdruck, der zu einem Versagen in der Schule führte. Edels Bekenntnis, er habe nicht gut auswendig lernen können, vermittelt eine Ahnung von der Notwendigkeit, aus einer vermeintlichen Schwäche Selbstbewußtsein zu ziehen, sie in eine Stärke umzumünzen. „Wer kann Alfred Edel prüfen?“, habe er sich nach dem Abitur gefragt. Seine mit Stolz erinnerte Antwort: „Niemand.“ Es geht um Protest. Kluge zeigt Edel als Gegner der Erziehung und der gesellschaftlich vorgezeichneten Entwicklungslinien, als einen, der sich selbst und seiner Erfahrung mehr vertraut als den Schematismen und Klapperbegriffen der Universitäten, in deren Umfeld sich Edel doch gern aufgehalten hat.
Jede Generalisierung sei bereits Metaphysik, sagt er und lobt Karl Valentin als Philosophen, für den nur der Einzelfall gegolten habe. Jede Sache zunächst einmal für sich zu betrachten, diese Haltung setzt Interesse und Neugier voraus, aber auch die Fähigkeit, die hierarchischen Einteilungen der Wirklichkeit zu ignorieren. Wem die Dinge gleich nah sind, der hat auch Distanz genug, um sie zu erkennen. Gewiß, die Werbung war Edel vertraut, schließlich arbeitete er jahrelang als Ideenlieferant für diverse Agenturen. Von Kluge nach ihren Grundbegriffen befragt, repliziert er aber nicht in der apologetischen Manier des Repräsentanten, sondern als einer, der die Sache durchdacht hat: „Penetranz vor Varianz“, heißt das knappe Theorem, das ebensogut Resultat einer genauen Adorno-Lektüre sein könnte. Daß Edel die Dialektik der Aufklärung vertraut war, demonstriert Kluge mit einem Ausschnitt aus der Fernsehsendung Alfred und Alfred, der, wie uns ein Insert erklärt, den Darsteller „im philosophischen TV-Sondereinsatz mit Prof. Dr. Alfred Schmidt“ zeigt, einem prominenten Horkheimer-Schüler. Dieser durchaus mutige Beitrag des Hessischen Rundfunks lud die Zuschauer zu einem Tonlagen-Vergleich ein, der zuweilen an die Interview-Szenen in Kluge-Filmen erinnerte, vor allem aber deutlich machte, daß es eine besondere Erfahrungsqualität haben kann, wenn dem Schulphilosophen, für den Reden und Dozieren ein und dasselbe sind, ein Eulenspiegel gegenüber sitzt, der das Inkommensurable, Nichtidentische schon durch seine bloße Präsenz aufblitzen läßt: Edel, das lebendige Differential.
Kluge interessiert sich weniger für Meinungen als für Haltungen, genauer: für imaginierte Haltungen. Er fragt ihn, wie er in einem Zugabteil „eine schöne Dame“ ansprechen würde. Edel: „Ich würde in der Liebe kein Klischee auslassen.“ Kluge übernimmt kurzerhand die Rolle der Schönen, scheint aber an diesem Tag keine Lust auf Eroberungen zu haben, denn er spielt sie derart spröde und abweisend, daß Edel nach wenigen Anläufen das Handtuch wirft. Dabei hätte der es doch gar nicht zum Äußersten kommen lassen, die Adresse der Frau, räumt er ein, hätte ihm genügt. Daß Kluge nachfragt, was er denn mit dem Äußersten meine, versteht sich schon von selbst. Es ist diese Lust am Fabulieren, am öffentlichen Gebrauch der Phantasie, die beiden eigen ist und die weniger auf ein Verstehen angelegt ist, das vielleicht nebenbei herausspringt, sondern primär darauf, das eigene Wirklichkeitsverhältnis im Dialog auszuloten, nicht Sinn zu produzieren, sondern Ausdruck. Edel wirkt wie die lebendige Inkarnation des Kluge-Satzes „Wenn ich alles verstanden habe, ist etwas leer geworden.“ Und als sähe er es als seine Mission an, gegen die drohende Verstehens-Leere vorzugehen, produziert er gelegentlich Wortgebilde, die ebenso genau wie rätselhaft anmuten. So belegt er Schlingensiefs Filme, in denen er spielte, mit dem Attribut „bio-informativ“, und Hitler, auf den Kluge auf dem Umweg über Astrologie zu sprechen kommt, habe, sagt er, an „spekulative Trivialmomente“ geglaubt. Edels hybride Antworten enthalten schon immer neue Fragen, von denen man den Eindruck gewinnt, daß er, wenn Kluge es nicht täte, sie sich selber stellen würde, nur um abermals dem Sinnzwang die Narrenkappe aufsetzen zu können.
Kluge liebt es, die Geschichte im Konjunktiv durchzuspielen, im Realen das Fiktive sichtbar zu machen und die Fiktion auf realistische Aspekte hin abzuklopfen: der Glaube an den Möglichkeitssinn als letztes Utopiereservat. Sein einziges Prinzip: Alles, was man sich vorstellen kann, hat Anspruch darauf, als wirklich zu gelten. Was Edel sich alles vorstellen und spontan in eine Haltung bzw. Szene übersetzen konnte, zeigt sich nicht allein im Gespräch, sondern mehr noch in den Filmausschnitten, die Kluge wie Nummern eines Zirkusprogramms in seine Sendungen eingestreut hat. Das Ganze hat den Charakter einer Ein-Mann-Revue, die Edel in den verschiedensten Rollen (bei Kluge, Schlingensief, Straub, Herzog u. a.) zeigt, aber auch in solchen, die er nie gespielt hat. Denn Kluge collagiert das Gesicht seines Helden wie eine Maske in die stills aus Filmen, in denen der „Verwandlungskünstler“ (Insert) vielleicht die bessere, bestimmt aber die authentischere und vitalere Alternative gewesen wäre. Wir sehen ihn in Der große König, in Leutnant Gustl oder in Der Graf von Ory und hören dazu Goodbye Johnny, gesungen von Hans Albers, seinem Idol. So protestiert der Regisseur gegen den Tod seines Darstellers, indem er zeigt, was dieser alles hätte spielen können. Er inszeniert Edel als Potential, als Kraftreserve der Filmgeschichte, die sich ihrerseits, so suggeriert der Eingriff, zu einer Hommage um ihn herum versammelt. Aber am Ende der 100-minütigen Edel-Gala („Adieu für Alfred Edel“) werden wir dann doch eines Besseren belehrt: der letzte Lokaltermin ist in Wahrheit ein Anfang. Wir verfolgen das Beerdigungszeremoniell in Edels bayrischem Heimatort, hören die Totenrede des Pfarrers und sehen, wie der Sarg in die enge Paßform des Grabes herabgelassen wird. Wir sagen adieu und denken: Das war’s. Aber dann ein abrupter Schnitt. Wir blicken ins Innere einer dunklen Kabine und sehen Alfred Edel, wie er, deutlich verjüngt und vor Kraft strotzend, mit Händen und Füßen gegen die 80-cm-Enge seines Gelasses Einspruch erhebt: „Ich will hier raus!“ Irgendwie scheint er es geschafft zu haben, denn im nächsten Bild steigt er gut gelaunt aus einer Gruft, pfeifend und die Aktentasche unter dem Arm verschwindet er aus dem Bild. Edel lebt also weiter, in der einzigen Hauptrolle, die er bei Kluge spielte, als Willi Tobler im Jahr 2044, „als Reisender unter dem Sternenzelt“. So viel Hoffnung war nie.
Quelle: Von Christian Schulte. Das Edelbuch, hg. von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen, Berlin: Verbrecher-Verlag 2004.